
- DAZ.online
- News
- Pharmazie
- Verbessern Antidepressiva...
Anhaltende Debatte
Verbessern Antidepressiva die Lebensqualität?
Stuttgart - 22.04.2022, 12:15 Uhr

Ein Experte mahnt angesichts einer neuen Studie zu Antidepressiva, dass sie keine eindeutige Schlussfolgerung für die Behandlung von Patienten habe. Deshalb sollten sie sich auf keinen Fall entmutigen lassen. (b/Foto: Maridav / AdobeStock)
Eine aktuelle Studie hat erneut die Frage aufgeworfen, inwieweit Antidepressiva (allein) wirklich die Lebensqualität Betroffener verbessern können. Während die konkrete Studie von Expertinnen jetzt stark kritisiert wird, halten einige davon die damit erneut angestoßene Debatte dennoch für sinnvoll. Sollte die nicht-medikamentöse Therapie in Zukunft einen noch höheren Stellenwert bekommen?
Auf der INTERPHARM 2020 erläuterte Prof. Dr. med. Thomas Herdegen, stellvertretender Direktor des Instituts für Experimentelle und Klinische Pharmakologie an der Universität Kiel, anhand der Arzneimittelklasse der Trizyklika die Geschichte der psychiatrischen Erkrankungen: Erst 1950 synthetisierte der französische Chemiker Paul Charpentier in Lyon mit Chlorpromazin das erste Trizyklikum, was den Beginn der modernen Neuropharmakologie markiert haben soll. „Durch die Einführung der trizyklischen Neuroleptika konnten Patienten mit Schizophrenie und anderen psychiatrischen Erkrankungen zwar nicht geheilt werden; es wurde jedoch möglich, sie auch außerhalb geschlossener Anstalten zu betreuen, sodass sich ihre Lebensqualität deutlich erhöhte“, schrieb DAZ-Autorin Dr. Claudia Bruhn im September 2020 unter Berufung auf Herdegen. Arzneimittel statt Zwangsjacke – das klingt nach einer deutlichen Erhöhung der Lebensqualität.
Mehr zum Thema

Interpharm 2020 – die „Herren der Ringe“
Der Stellenwert von Trizyklika bei psychiatrischen Erkrankungen

Die Sicht der Patienten: klassische Antipsychotika und Atypika im Vergleich
Bessere Lebensqualität unter Atypika

Neue Netzwerke entstehen
Wie verändert Psilocybin das Gehirn bei Depression?
Ähnlich wie die trizyklischen Antipsychotika seien auch die trizyklischen Antidepressiva wie Amitriptylin, Imipramin oder Trimipramin wegen ihrer vielfältigen Angriffsorte „pharmakodynamische Alleskönner“, hieß es auf der INTERPHARM. Allerdings würde bei diesen Wirkstoffen manchmal argumentiert, dass der Unterschied in der Wirkstärke zwischen Verum und Placebo nicht besonders groß sei. Doch Herdegen verwies darauf, dass in Studien auch Placebo-Gruppen in das Studienprotokoll eingebunden seien. Placebo bedeute also nicht „nichts tun“.
Kein Effekt von Antidepressiva auf die Lebensqualität nach zwei Jahren?
Jetzt informiert das „Science Media Center“ (SMC) in Deutschland über eine Studie, die Gesundheitsdaten von über 17 Millionen Patienten und Patientinnen aus den USA ausgewertet hat. Sie ist in „PLOS One“ erschienen und hat den Effekt von Antidepressiva auf die Lebensqualität nach zwei Jahren untersucht. Die Forschergruppe aus Saudi-Arabien (eine Forscherin aus den USA) kommt in der Zusammenfassung ihrer Studie zu dem Schluss, dass die Einnahme von Antidepressiva die Lebensqualität im Laufe der Zeit nicht verbessert. Deshalb sollten künftige Studien ihrer Meinung nach sich nicht nur auf die kurzfristigen Wirkungen einer Pharmakotherapie konzentrieren, sondern vielmehr langfristige (pharmakologische) Interventionen und deren Einfluss auf die Lebensqualität untersuchen.
Kritik an der Studie
Allerdings handelt es sich bei der Studie um eine retrospektive Beobachtungsstudie, wie das SMC einordnet. Sie kann also keine kausalen Zusammenhänge nachweisen. Sie basiert auf einer nationalen, repräsentativen Gesundheitsbefragung aus den USA, welche die gesamte Bevölkerung repräsentieren soll („Medical Expenditures Panel Survey“). Darin wurde die gesundheitsbezogene Lebensqualität über einen Fragebogen aus zwölf Fragen erhoben. Informationen darüber, ob die Patienten und Patientinnen eine Psychotherapie oder eine andere nicht-pharmazeutische Behandlung erhalten haben, seien in der Auswertung allerdings nicht enthalten. Auch die Schwere der Depression der Probanden sei nicht bekannt. Sie könnte sich also zwischen den beiden Gruppen unterscheiden. Außerdem unterscheiden sich die beiden Gruppen – mit und ohne Antidepressiva – leicht in mehreren Faktoren, etwa Ethnizität, Einkommen oder Versichertenstatus.
Was sagen die bisherigen Studien?
So betrachtet ist die Studie also wenig aussagekräftig. Allerdings fügt sie sich ein, in eine fortbestehende wissenschaftliche Debatte. So haben laut SMC frühere Meta-Analysen, den Effekt von Antidepressiva in randomisierten klinischen Studien mit geringeren Stichprobengrößen und kürzeren Beobachtungszeiträumen untersucht. Diese Meta-Analysen würden, mit kleinen bis moderaten Effektstärken, zeigen, dass Antidepressiva kurzfristig wirksamer als Placebo sind. Sie sollen die Lebensqualität geringfügig verbessern. In Kombination mit einer Psychotherapie sind sie außerdem effektiver als Antidepressiva oder Psychotherapie allein. Dennoch: Laut einer Meta-Analyse aus 2009 sollen rund 70 Prozent des Effekts von Antidepressiva auf den Placebo-Effekt zurückzuführen sein.
So ordnen Expert:innen die Ergebnisse der neuen Studie ein
Prof. Dr. Eva-Lotta Brakemeier, Professorin für Klinische Psychologie und Psychotherapie sowie Direktorin des Zentrums für Psychologische Psychotherapie (ZPP) an der Universität Greifswald, kritisierte gegenüber dem SMC an der Studie vor allem, dass bei den über 17 Millionen Erwachsenen mit einer Depressionsdiagnose – welche über zwei Jahre wiederholt untersucht wurden – nicht erfragt wurde, ob die Betroffenen während dieser Zeit eine Psychotherapie durchgeführt haben: „Da mittlerweile sämtliche nationale und internationale Leitlinien für die Behandlung der Depression die Psychotherapie als Methode der ersten Wahl empfehlen – bei schweren Formen und chronischen Verläufen in Kombination mit Antidepressiva –, erscheint mir diese Nicht-Berücksichtigung sowohl aus wissenschaftlicher als auch konzeptioneller Sicht gravierend.“
Sollten Ärzt:innen stärkere Zurückhaltung bei der medikamentösen Behandlung zeigen?
Prof. Dr. Tom Bschor, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie und Mitglied der Arzneimittelkommission der deutschen Ärzteschaft (sowie Professor an der Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie, Universitätsklinikum Carl Gustav Carus, Technische Universität Dresden), fällt außerdem auf, dass es sich um eine Zweitauswertung handelt, die primär zur Abschätzung von Gesundheitskosten durchgeführt wurde: „Interessanterweise besteht das Autorenteam nur aus einer Wissenschaftlerin aus den USA und ferner fünf Forschern aus Saudi-Arabien. Die Autoren begründen ihre Analyse sehr stark mit den hohen Kosten, die Depressionen für die Gesellschaft verursachen. Da die Studie aber die gesundheitsbezogene Lebensqualität untersucht, hätte vielleicht erwartet werden können, dass die Autoren das subjektive Leid und die subjektiven Einschränkungen depressiver Menschen, am allgemeinen Leben zu partizipieren, als zentrale Motivation für ihre Studie präsentieren.“
Bschor meint sogar, dass man die Studienergebnisse auch ganz anders lesen könne: „Die gesundheitsbezogene Lebensqualität der Studienteilnehmer blieb von der Baseline- zur Follow-up-Untersuchung erstaunlich konstant – ganz unabhängig davon, ob Antidepressiva eingenommen wurden oder nicht.“ Zu bedenken sei in diesem Zusammenhang, dass die Lebensqualität durch die Nebenwirkungen von Antidepressiva auch negativ beeinflusst werden könnte – zum Beispiel durch starke Müdigkeit tagsüber oder durch sexuelle Beeinträchtigungen.
Interessant sei die Studie aber: „Dennoch hat die Studie einen hohen Wert, da sie im Unterschied zu den nur auf wenige Wochen angelegten randomisierten Studien einen Verlauf von zwei Jahren beobachtete und da sie ein realistisches Abbild der tatsächlichen Behandlungssituation gibt.“ Die aktuell vorgelegte Studie unterstütze die Erkenntnisse aus randomisierten Studien. „Wenn die Ergebnisse von randomisierten Studien und von populationsbezogenen Studien – wie der vorgelegten – zum gleichen Ergebnis kommen, kann mit hoher Sicherheit angenommen werden, dass das Ergebnis die tatsächliche Situation beschreibt“, meint er.
Außerdem findet Bschor, dass die Autoren am Ende ihrer Publikation zurecht darauf hinweisen, dass Ärztinnen und Ärzte eine stärkere Zurückhaltung bei der medikamentösen Behandlung von Depressionen zeigen sollten – „nicht nur wegen des fehlenden Effekts auf die Lebensqualität, sondern da sich die Befunde mehren, dass die Verordnung von Antidepressiva langfristig zu einer Verschlechterung des Krankheitsverlaufes mit Chronifizierung und häufigeren Rückfällen der Depression und in der Folge der Notwendigkeit einer Dauerverschreibung von Antidepressiva führt.“ Er hält es also wie die Studienautor:innen für sinnvoll, wenn andere Behandlungsmöglichkeiten wie Psychotherapie, Hilfe zur Selbsthilfe, Aufklärung, Tagesstrukturierung und soziale Unterstützung vor der Verordnung von Antidepressiva eingesetzt werden.
Kritik am Beobachtungszeitraum
Dr. Rebecca Sheriff von der „University of Oxford“ (Consultant Psychiatrist and Senior Clinical Research Fellow) kritisiert allerdings, dass der Beobachtungszeitraum von zwei Jahren viel zu kurz gedacht sei. Unter echten Langzeitdaten würde sie einen Zeitraum von fünf bis zehn Jahren verstehen. Auch sie kritisiert viele andere Punkte an der Studie, hält die damit (erneut) aufgeworfenen Fragestellung aber für sinnvoll.
Prof. Andreas Reif, Leiter der Abteilung für Psychiatrie am Universitätsklinikum Frankfurt (Goethe-Universität) hält den verwendeten Zeitrahmen wiederum grundsätzlich nicht für angemessen. In 90 Prozent der Fälle seien Depressionen episodische Störungen. Dies bedeute, dass sie in der Regel innerhalb von neun Monaten wieder abklingen würden.
Mehr zum Thema

Umstrittene Studie mit depressiven Jugendlichen wird neu analysiert
Paroxetin doch nicht besser als Placebo
Bei welchen Arzneistoffen tatsächlich Beratungsbedarf besteht
(Fehl-)Alarm Serotonin-Syndrom

Beide Therapieoptionen zeigen ähnliche Wirksamkeit
Antidepressiva oder Verhaltenstherapie?
Dr. Gemma Lewis vom „University College London“ (Sir Henry Dale Fellow, Division of Psychiatry) gibt einen weiteren zeitlichen Aspekt zu bedenken: Auch das Datum, wann die Einnahme der Antidepressiva begonnen hat, sei zu berücksichtigen. Viele der Proband:innen hätten ihre Medikation wahrscheinlich schon jahrelang eingenommen, als die Studie begann. Kurz nach Einnahmebeginn hätte man also vielleicht eine größere Verbesserung der Lebensqualität feststellen können. Die langfristige Einnahme vom Antidepressiva könnte währenddessen das Rückfall-Risiko verringern, und so die Lebensqualität erhalten.
Prof. Michael Sharpe, ebenfalls von der „University of Oxford“ (Professor of Psychological Medicine), mahnt abschließend in seinem Statement: „Diese Studie hat keine eindeutige Schlussfolgerung für die Behandlung von Patienten mit Depressionen und sollte Patienten, die von der Einnahme dieser Medikamente profitieren könnten, auf keinen Fall entmutigen.“


















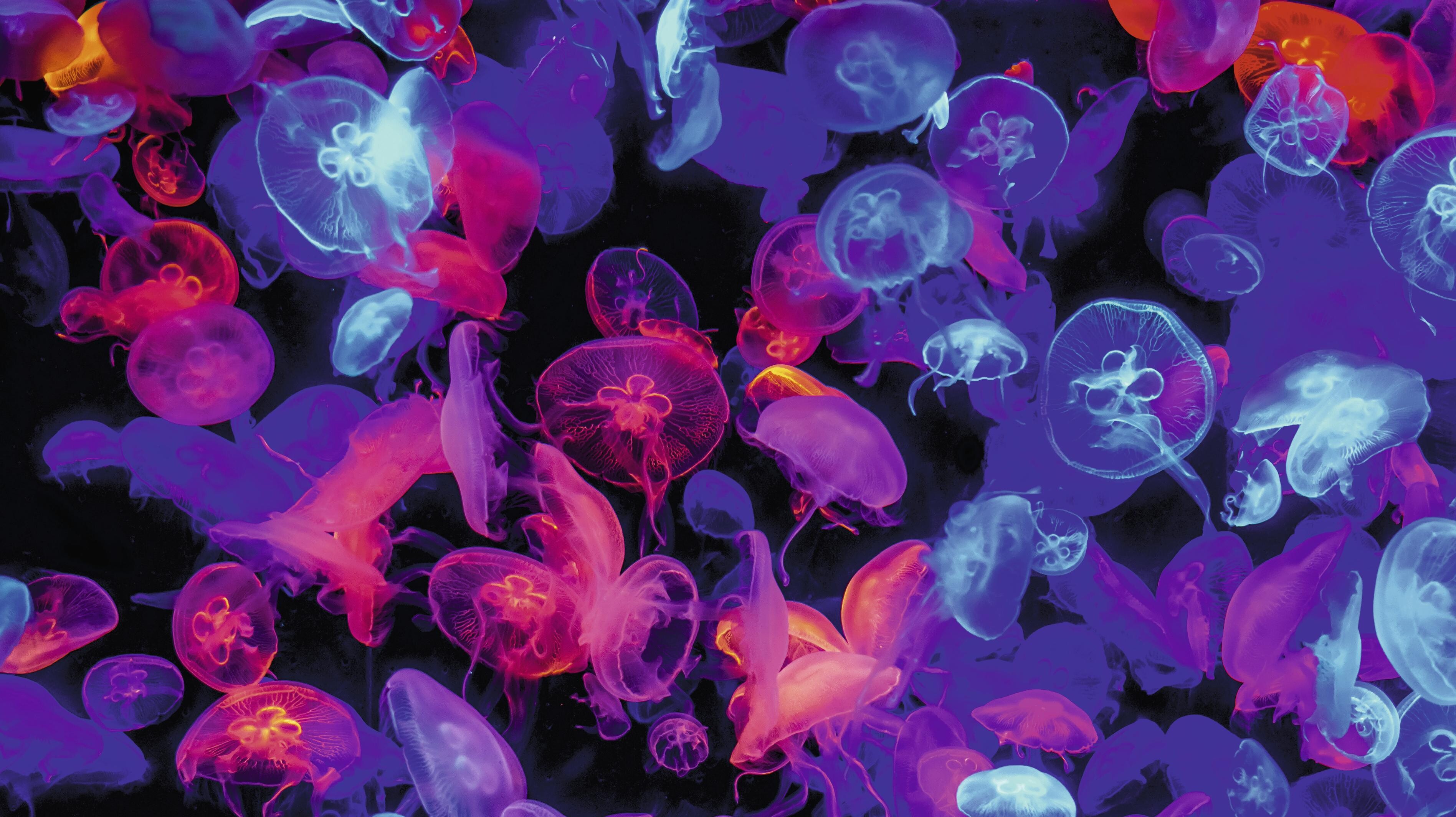



0 Kommentare
Das Kommentieren ist aktuell nicht möglich.