
- DAZ.online
- DAZ / AZ
- DAZ 25/2005
- Der kleine Unterschied...
DAZ aktuell
Der kleine Unterschied – auch bei Arzneimitteln gibt es ihn
Ulla Schmidt hat schon bald nach Aufnahme ihrer gesundheitsministeriellen Tätigkeit die bemerkenswerte Feststellung getroffen, dass das Wichtigste am Arzneimittel der Wirkstoff ist. Auch wenn diese Feststellung nur bedingt richtig ist, hat sie doch jedermann sofort eingeleuchtet. Einen Aufschrei jener, die es besser wissen müssten (die Pharmazeuten), gab es allerdings nicht. So war es dann in der Folge auch nicht schwer, Arzneimittel als Substanzen zu betrachten, sie in Listen einzuordnen, Aut-idem-Regelungen einzuführen und Preisvergleiche anzustellen.
Denn wenn "Arzneimittel" nur ein Synonym für "Wirkstoff" ist und zwei Arzneimittel den gleichen Wirkstoff und Wirkstoffgehalt haben, dann müssen sie auch gleich wirken und für alle den gleichen Nutzen haben, das muss doch jedem einleuchten. Also ist es nur folgerichtig, dass Frau Schmidt jetzt anlässlich der Vorstellung des aktuellen Arzneimittelreports fordert: "Wenn 20 Medikamente die gleiche Wirkung, aber ganz unterschiedliche Preise hätten, müsse das Billigste verschrieben werden", denn – das weiß sie auch aus dem Report – "drei Milliarden Euro würden für Arzneimittel ausgegeben, die den Patienten nicht besser helfen als preisgünstigere." (Frage: Wer hat in der Studie eigentlich entschieden, welches ein "nützliches" und welches ein "überflüssiges" Arzneimittel ist?)
Was ist Sache? Wie allgemein bekannt, kommen heute vorwiegend chemisch definierte Wirkstoffe in der medikamentösen Therapie zur Anwendung. Wie ebenfalls – vor allem den Pharmazeuten – bekannt, muss eine pharmakologisch wirksame Substanz aber nicht notwendigerweise ein wirksames und unbedenkliches Arzneimittel sein. Möglicherweise hat das von Ehrlich für die Chemotherapie entwickelte "Schlüssel-Schloss-Konzept" die Aufmerksamkeit zu sehr auf das Verhältnis zwischen chemischer Struktur und pharmakologischer Wirkung gelenkt (was übrigens auch zur Folge hat, dass die Pharmakologen in der Öffentlichkeit als die eigentlichen Arzneimittelexperten angesehen werden, wo doch die meisten von ihnen zwar viel von Pharmakologie, aber wenig von Arzneimitteln verstehen).
Dass eine wirksame Substanz erst dann ein wirksames Arzneimittel werden kann, wenn sie in entsprechender Weise zubereitet wird, ist pharmazeutisches Grundwissen. Vor allem in den 80er-Jahren hat man näher erkannt, dass die Arzneiform die therapeutische Wirkung der pharmakologisch wirksamen Substanz ganz wesentlich beeinflussen kann – negativ wie positiv –, eine Erkenntnis, deren Umsetzung wir heute eine Vielzahl neuer Darreichungsformen verdanken.
Wenn man also davon ausgeht, dass die Zubereitung vor allem für die Freistofffreisetzung des Wirkstoffs und damit für alle sich daran anschließenden Prozesse im Körper (nicht nur die "biologische Verfügbarkeit") eine entscheidende Bedeutung hat, dann ist eben nicht (wie Frau Schmidt und einige ihrer Berater glauben) der Wirkstoff schon das Arzneimittel. 20 Betablocker gleichen Typs und gleichen Wirkstoffgehalts müssen keineswegs bei allen die gleichen Wirkungen auslösen, was bedeutet, dass einem Patienten eben nur der zwanzigste Betablocker hilft, die neunzehn anderen aber nicht.
Ach ja, die Analogpräparate! Sie breiten sich zwar nicht wie die viel zitierten Heuschrecken aus, sind aber (nach Glaeske) doch eine Plage. Ungeachtet der Frage, welche Motive ein Pharmaunternehmen leiten, ein Me-Too-Präparat auf den Markt zu bringen, darf man dem Arzt durchaus unterstellen, ein solches nur dann einzusetzen, wenn er sich von diesem für seine Patienten auch Vorteile (geringere Nebenwirkungen, längere Wirkdauer etc.) verspricht, denn nur zufriedene Patienten bleiben ihm.
Auch wenn Glaeske feststellt, dass Analogmittel keinen Fortschritt darstellen, weil sie nur "marginale Veränderungen eines bekannten Wirkstoffs" bieten, scheint der damit verbundene Zusatznutzen doch gefragt zu sein, wie aus einer soeben an GKV-Versicherten vorgenommenen Emnid-Studie hervorgeht. Eine Diskrepanz? Keineswegs, denn das, was für den Pharmakologen nur ein "marginaler Unterschied" ist, kann eben für den Patienten ein "kleiner Fortschritt" sein.
Klaus Heilmann
Prof. Dr. med. Klaus Heilmann beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit Risikoforschung, Krisemanagement und Technikkommunikation. In der DAZ-Rubrik "Außenansicht" befasst sich Heilmann mit Themen der Pharmazie und Medizin aus Sicht eines Nicht-Pharmazeuten vor dem Hintergrund seiner Erfahrungen.




















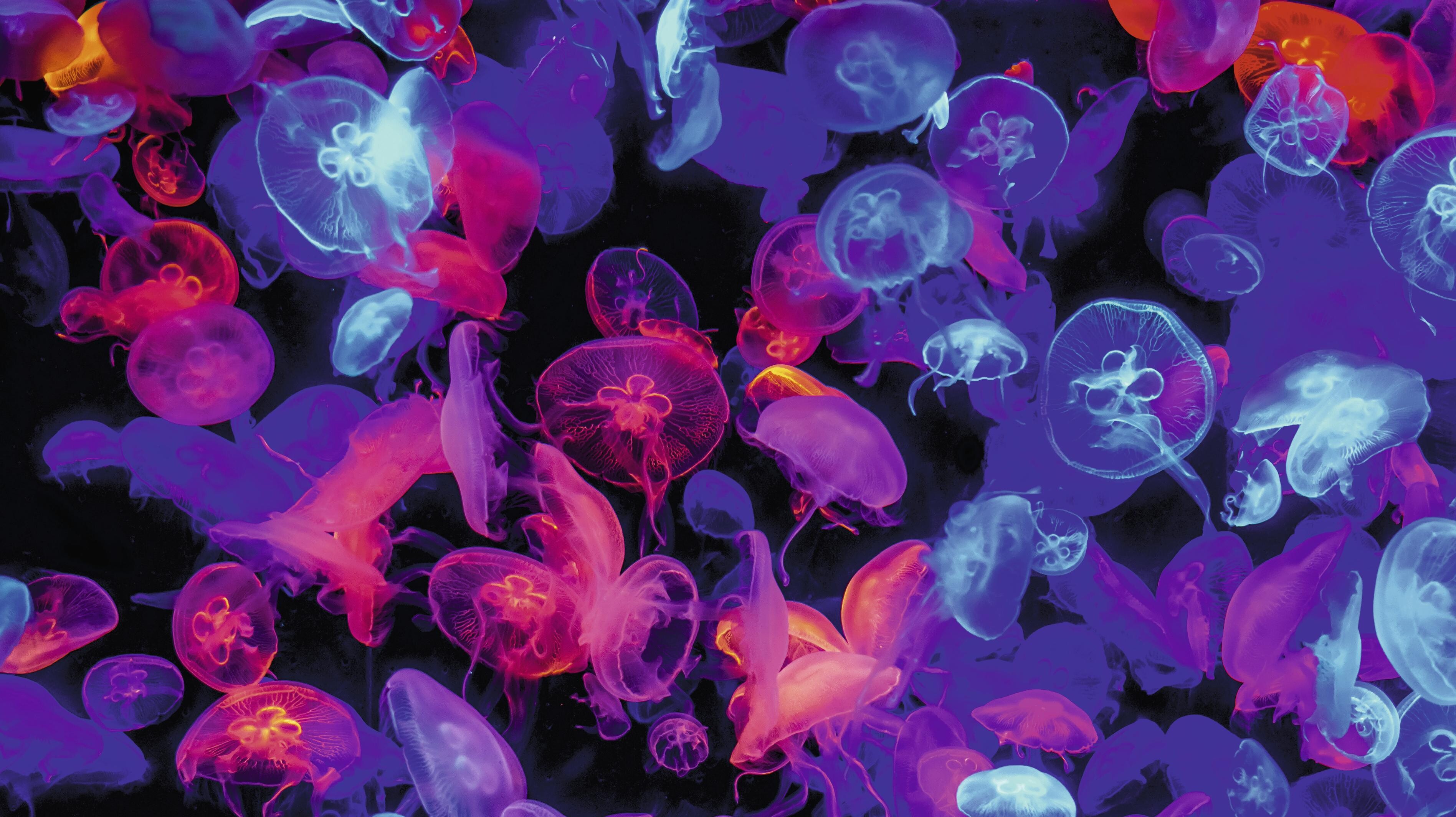



0 Kommentare
Das Kommentieren ist aktuell nicht möglich.