
- DAZ.online
- News
- Wirtschaft
- Viel Geld für nichts
Pharmaabsprachen auf dem Prüfstand
Viel Geld für nichts
München - 24.10.2016, 07:00 Uhr

Es fließt viel Geld zwischen Pharmaunternehmen. (Foto: vege / Fotolia)
Immer wieder zahlen Pharmaunternehmen Millionen an Generikahersteller, damit diese kein Nachfolgeprodukt auf den Markt bringen. Patentexperte Filipe Fischmann hat untersucht, wo die Grenzen solcher Zahlungen liegen.
Das Phänomen wirkt auf den ersten Blick kurios, ergibt bei genauerem Hinsehen für die Beteiligten aber Sinn: Forschende Pharmaunternehmen zahlen Generikaherstellern Millionen oder gar hunderte von Millionen Euro, damit diese keine Nachfolgearznei des Originals auf den Markt bringen. Bei solchen Deals freuen sich beide Seiten: Der Generikahersteller, weil er ohne großen Aufwand viel Geld kassiert. Und das forschende Pharmaunternehmen, weil es Zeit gewinnt, in der es seine Originalarznei weiter zum höheren Preis vermarkten kann.
Dr. Filipe Fischmann (33), Jurist und Wissenschaftlicher Referent am Max-Planck-Institut für Innovation und Wettbewerb in München, beschreibt in seiner Dissertation die Hintergründe und Mechanismen dieser Praxis und zeigt, wie einfallsreich forschende Pharmaunternehmen sind, wenn es um die Optimierung ihres Umsatzes geht. Von der Koerber Stiftung wurde er dafür kürzlich mit dem zweiten Platz des Deutschen Studienpreises ausgezeichnet.
Konkret führt Fischmann aus, dass die Unternehmen zusätzlich zum Hauptpatent eines Arzneimittels, dem Wirkstoffpatent, oftmals zusätzliche Patente beantragen – beispielsweise für Herstellungsverfahren, zur Behandlung weiterer Krankheiten, zur Dosierung oder für Zwischenprodukte. Da die Unternehmen die Zusatzpatente meist erst Jahre nach dem Ursprungspatent beantragen, können sie so den effektiven Schutz für ihre Arzneimittel deutlich verlängern.
Unklarheit über rechtlichen Bestand
Doch ob diese Zusatzpatente tatsächlich Bestand haben, ist oft nicht eindeutig. Nach Fischmanns Erkenntnissen, der an der Universität von São Paulo und an der Ludwig-Maximilians-Universität München Rechtswissenschaften studierte, besteht nämlich vielfach Unklarheit darüber, ob ein Patent ausreichend geprüft und zu Recht vergeben worden ist. Angesichts dessen wagen sich die Generikahersteller gerne aus der Deckung und stellen die Zusatzpatente infrage. Deren Argument: Die fraglichen Schutzrechte erfüllen nicht die gesetzlichen Voraussetzungen der Neuheit beziehungsweise der erfinderischen Tätigkeit. Und selbst wenn diese Patente die Voraussetzungen erfüllen würden, könnten sie nicht unbedingt die Nachahmung der Original-Arznei verhindern, da das fragliche Präparat auf alternative Weise hergestellt werden könne. Die Zusatzpatente würden in diesem Fall durch die Herstellung und Vermarktung der Nachahmerarzneimittel nicht verletzt.
Offenbar sind die Generikahersteller mit dieser Methode ziemlich erfolgreich. Laut einer Untersuchung der Europäischen Kommission siegten die Generikahersteller in 62 Prozent der Patentrechtsverfahren, welche von einem Gericht entschieden wurden. In diesen Fällen durften die Unternehmen ihre Generika also vermarkten.
Allerdings: In vielen Fällen kommt es erst gar nicht zu einer gerichtlichen Entscheidung. Oftmals legen forschende Pharmaunternehmen und Generikafirmen ihren Streit nämlich per Vergleich gütlich bei: Mittels einer Millionenzahlung verzichtet der Generikahersteller darauf, sein Nachfolgeprodukt auf den Markt zu bringen. Diese Lösung hat zudem den Charme, dass beide Parteien einen teuren und möglicherweise langen juristischen Prozess mit ungewissem Ausgang vermeiden. Fischmann: „Kartellrechtliche Verfahren von mehr als 15 Jahren bis zur endgültigen Sanktionierung einer Absprache sind keine Seltenheit.“
Gesellschaft trägt die Kosten
Während die beteiligten Unternehmen bei derartigen Deals – in der Fachsprache auch Reverse Payments genannt – gewinnen, trägt die Gesellschaft die Kosten. Denn die Krankenkassen und damit letztlich die Versicherten müssen höhere Preise für Arzneimittel zahlen als nötig. In Ländern mit wenig entwickelten Gesundheitssystemen kann dies laut Fischmann sogar so weit führen, dass Patienten mit schweren Leiden leben müssen oder gar sterben, weil eine notwendige medizinische Behandlung aufgrund des hohen Preises nicht durchgeführt werden kann.
Eine Lösung wäre, dass erst gar keine fehlerhaften und damit angreifbaren Patente erteilt werden. Doch das hält Fischmann in der Praxis nicht für machbar. Denn dies würde eine intensivere Prüfung von Patentanträgen und damit noch längere Verfahren nach sich ziehen sowie Erfindungen mit zweifelhaftem Schutz länger schützen.
Stattdessen plädiert er dafür, fehlerhaft erteilte Patente verstärkt durch Einspruchsverfahren beziehungsweise Nichtigkeitsverfahren zu korrigieren. Dazu müssten jedoch stärkere rechtliche Anreize zur Einleitung derartiger Verfahren geschaffen werden. Die Gerichte wiederum sollten dafür sorgen, dass Personen und Einrichtungen, die aufgrund der Absprachen einen Schaden erlitten haben, angemessenen Ersatz erhalten. Die gerichtlichen Verfahren sollten laut Fischmann zudem vom Gesetzgeber beschleunigt werden. Schließlich spricht er sich auch dafür aus, Zertifikate einzuführen, die darüber informieren, welche Patente gründlich überprüft wurden und welche nicht. Damit würde weniger Ungewissheit über die Qualität von Patenten bestehen.
Schmerzhafte Sanktionen
Auch ohne solche Maßnahmen sanktionieren die Kartellbehörden bereits heute Reverse Payments. Für die betroffenen Unternehmen ist dies oftmals schmerzhaft, denn die Bußgelder betragen teilweise mehrere hundert Millionen Euro. Darüber hinaus könnten Personen oder Sozialleistungsträger, die aufgrund solcher Vereinbarungen einen Schaden erlitten haben, Schadensersatz verlangen.
So hat die Europäische Kommission im Dezember 2013 Johnson & Johnson ein Bußgeld von 10,8 Millionen Euro und Novartis von 5,5 Millionen Euro auferlegt, weil sie einen Generikahersteller im Rahmen eines Co-Promotion Agreements bezahlt hatten. Damit sollte der Markteintritt des Fentanyl-Generikums, eines Schmerzmittels, verzögert werden.
Im April 2011 leitete die Kommission ein Verfahren gegen den Originalhersteller Cephalon und das Generikaunternehmen Teva ein. Grund war ein Vergleichsvertrag, der einen gerichtlichen Streit zwischen Cephalon und Teva in den USA gütlich beilegte. Nach dieser Vereinbarung verpflichtete sich Teva unter anderem zur Nichtvermarktung von Generika mit dem Wirkstoff Modafinil.
Lundbeck im Fokus der EU
Im Fall des dänischen Pharmakonzerns Lundbeck nahm die EU-Kommission gleich sechs Vereinbarungen unter die kartellrechtliche Lupe, die das Unternehmen mit Generikaherstellern geschlossen hatte. Insgesamt zahlte Lundbeck an diese etwa 66,8 Millionen Euro, damit sie ihre Citalopram-Generika, ein Antidepressivum, für eine vereinbarte Zeit nicht vermarkten.
Der Deal kam Lundbeck letztlich teuer zu stehen. Denn die EU-Kommission verhängte ein Bußgeld von etwas mehr als 146 Millionen Euro – allein die Strafe für Lundbeck betrug mehr als 93 Millionen Euro. Die Entscheidung der EU-Kommission wurde neulich vom Gericht der Europäischen Union bestätigt, ist allerdings noch nicht rechtskräftig, da die betroffenen Unternehmen sie vor dem Europäischen Gerichtshof anfechten können.
Fischmann hofft, dass eine härtere kartellrechtliche Sanktionierung von Reverse Payments nicht nur entstandene Schäden wiedergutmacht, sondern auch einen abschreckenden Charakter entfaltet. Für die Pharmahersteller könnte es dann richtig teuer werden.






















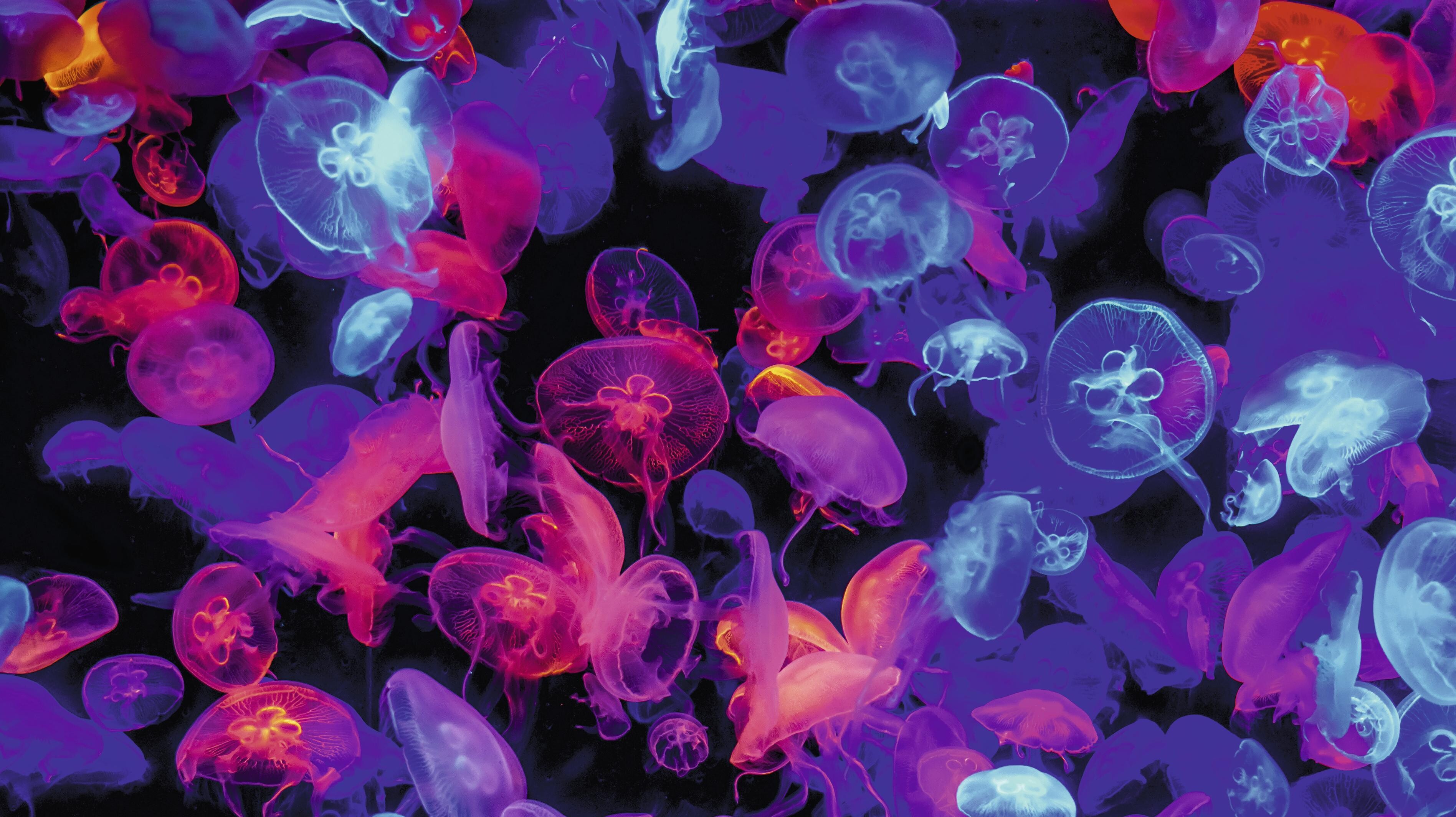



1 Kommentar
Die andere Seite der Medaille
von Jonas Fischer am 25.10.2016 um 10:20 Uhr
» Auf diesen Kommentar antworten | 0 Antworten
Das Kommentieren ist aktuell nicht möglich.