
- DAZ.online
- DAZ / AZ
- AZ 23/2011
- Immer weniger Ärzte? ...
Wirtschaft
Immer weniger Ärzte? Immer weniger Pflegeberufe?
Die Facetten des angeblichen Ärztemangels
Viele Prognosen müssen den Beweis ihrer Richtigkeit nicht mehr antreten. Kaum jemand schaut in den Rückspiegel – oder beschäftigen Sie sich noch damit, was 1990 gesagt wurde? Stattdessen lassen wir uns wieder von heutigen, oft klar interessengeleiteten Vorhersagen verrückt machen.
Besonders bei den Ärzten wird bereits seit einiger Zeit ein erheblicher Mangel prognostiziert. Tatsächlich tun sich Krankenhäuser schwer, die eine oder andere Stelle zu besetzen. Landarztpraxen drohen zu verwaisen. Der Altersdurchschnitt der Ärzteschaft liegt bei 52 Jahren (Durchschnittsbevölkerung: knapp 44 Jahre), 20% sind 60 und älter. Andererseits sind etwa 325.000 Ärzte in Deutschland tätig, 138.000 ambulant, rund 150.000 in Krankenhäusern, der Rest anderswo. Das ist im EU-Vergleich nicht wenig (Platz 4 einwohnerbezogen nach Griechenland, Italien und Belgien). Frankreich kommt mit rund 10% weniger Ärzten je Einwohner aus, Schweden mit 17%, England gar über 40%. Selbst wenn die Zahl der ausscheidenden Ärzte künftig zunimmt, ist da Spielraum. Bis 2020 scheiden beispielsweise etwa 7000 Hausärzte aus – das sind knapp 12% der Gesamtzahl, sofern sich nicht mehr Interessenten für dieses Fach finden. So betrachtet, muss die Kultivierung der Legende des Ärztemangels als ein Meisterstück der Selbstvermarktung gelten, denn wie sonst sind folgende Befunde zu erklären:
Deutschland leistet sich wie kaum sonst ein Land ein doppeltes Facharztsystem – in den Kliniken parallel zur Niederlassung.
Niedergelassene Ärzte sind bezüglich ihrer Praxiszeiten kreativ – einschließlich den üblichen "Quartalsferien", da ja das Budget (heute: Regelleistungsvolumen) vorzeitig "abgedient" ist. Bei einer Mangelsituation hingegen müssten die Praxen so berstend voll sein, dass an "Quartalsferien" gar nicht zu denken wäre
Dazu passt, dass wir uns international so ziemlich die höchste Arztbesuchszahl (etwa 18 pro Kopf und Jahr nach AOK-Auswertungen) leisten; gleichzeitig aber auch sehr kurze Kontaktzeiten: Masse statt Klasse, durch pauschalierte Mini-Honorare begünstigt.
Bei den Bettenzahlen pro Einwohner sowie den Liegezeiten in deutschen Krankenhäusern liegen wir im internationalen Vergleich nach wie vor im schlechteren Drittel.
Ärzte beklagen – zu Recht – die überbordende Bürokratie, die nach verschiedenen Schätzungen 20% bis 30% der Arztzeit verschlingt.
Der Fort- und Weiterbildungswahn nimmt inzwischen groteske Züge an, eine ganze Parallelindustrie hat sich mittlerweile etabliert. Für kleinste Zusatzleistungen werden immer mehr Zusatzqualifikationen und Zertifikate verlangt. Hat man früher eine Wunde einfach versorgt, so wird sie jetzt "gemanagt", das kosten- und zeitaufwendige Seminar dazu heißt folglich "Wundmanagement" und gestattet die Abrechnung einer Zusatzziffer im Wert von einigen, wenigen Euro.
Praxen finden auf dem Land keinen Nachfolger, obwohl sie gute Einkommen – bei allerdings spürbar höherer Arbeitsbelastung – versprechen. In attraktiven Städten sieht das jedoch immer noch ganz anders aus, dazu braucht man nur einmal die "Scheinzahlen" regional zu vergleichen. Offensichtlich sind die Bedingungen aber so gut, dass der unbequemere Weg aufs Land gescheut werden kann.
Obige Auflistung zeigt, dass es eine Gemengelage aus Überbürokratisierung, Fehlanreizen, zu viel staatlicher Intervention und Subvention sowie einem allgemeinen Mentalitätswandel ist, was dann zu einem letzten Endes nur künstlich induzierten Mangel führt.
An den Studienplätzen der Medizin (rund 10.000 bei 50.000 Bewerbern) hat sich seit vielen Jahren kaum etwas geändert, lediglich die Absolventenzahlen waren leicht rückläufig, stiegen aber jüngst wieder an – auf ebenfalls fast 10.000 jährlich. Wohl aber wandern Mediziner in andere Tätigkeiten oder gar ins Ausland ab. Übrigens kostet ein Medizinstudent mit rund 30.000 Euro pro Studienjahr etwa viermal soviel wie ein Studierender der Ingenieur- oder Naturwissenschaften, und die Studiendauer ist einige Semester länger. Es stellt sich an dieser Stelle schon die Frage nach der Ressourcenallokation: Kommt vor der Verteilung des sozialen Kuchens nicht erst einmal das Kuchenbacken, sprich, wo sollten wir die Mittel verstärkt konzentrieren, z. B. in Zukunftstechnologien?
Auch wenn es wenig in die politische Linie passen mag, die Antwort ist eben nicht immer mehr Geld. Oder wird sich ein Mediziner auf dem Land niederlassen, weil er in einer guten Praxis statt heute 160.000 Euro dann 200.000 Euro verdienen kann? Die Bezahlung ist es also nicht, vielmehr die mangelnde Arbeitszufriedenheit. Wie schafft es ein System, welches so viel Geld in die Hand nimmt, so viel Unzufriedenheit zu produzieren?
Bei der Suche nach dauerhaften Lösungen, jenseits des heutigen Reform-Reparaturbetriebes, wird man nicht umhin kommen, mehr Markt zuzulassen, Regulierungen und Fehlkapazitäten abzubauen sowie die Patienten mehr in die Verantwortung zu nehmen.
Schon ein Abbau der Parallelstrukturen und Überkapazitäten, eine transparente, faire Leistungshonorierung mit Patienten-Selbstbeteiligung sowie eine Reduktion von sinnfreien Vorschriften und Zertifizierungsorgien würde zu einem ganz anderen Befund führen. Plötzlich wären es nur noch 6 oder 7 Arztbesuche im Jahr. Viel Zeit würde plötzlich wieder in echte Arztzeit umgewidmet – mit dem Ergebnis, dass wir eine reichliche Ärzteversorgung, wahrscheinlich sogar Überkapazitäten hätten. Letzteres macht sich nicht gut in Honorarverhandlungen. Deshalb spielen alle das Spiel mit: Hier noch eine Zertifizierung, da noch mehr Qualität, dort noch eine Richtlinie ... Gut ist, was Arbeit schafft – und Personalmangel vortäuscht! Doch faktisch wird eben sehr viel Arbeit nur künstlich geschaffen. Die alte DDR lässt grüßen – auch dort herrschte Vollbeschäftigung!
Viel zu gering antizipiert werden dagegen die Umwälzungen des technischen Fortschritts. Das Vordringen neuer diagnostischer Verfahren für den Patienten zu Hause, allgemein zugängliche Datenbanken, die Vernetzung via Internet und Mobiltechnologien: All das resultiert in einem breit verfügbaren Wissen auf Knopfdruck. Das Allerweltswissen manch Arztes (und Apothekers!) wird von interessierten Patienten schon heute immer öfter überboten.
Dies alles wird sich ausweiten. Und siehe da: Viele heutige Leistungen werden entbehrlich! Andere werden an Bedeutung zunehmen, nämlich solche, bei denen Aufwand und Erfolg in einem guten Verhältnis stehen. Man denke hier nur beispielhaft an die enormen Fortschritte in der Chirurgie: Hier wird mit vergleichsweise überschaubarem Aufwand sehr viel erreicht. In vielen anderen Bereichen sehen die Relationen hingegen weit schlechter aus.
Pflegenotstand
Der personelle Exitus droht ebenfalls vielen Pflegeeinrichtungen, glaubt man einschlägigen Verlautbarungen. Bei einer Verdoppelung der Pflegefälle binnen der nächsten 30 Jahre scheint dies auf den ersten Blick einleuchtend zu sein, zumal viele Pflegefälle von morgen der kinderarmen "Generation Golf" von heute angehören. Da ist der familiäre Rückhalt vielfach dünn, das Heim eine drohende Notwendigkeit.
Doch so einfach ist es auch hier nicht. Wie vielfach betont, werden die Veränderungen durch den Fortschritt sowie die Verschiebungen im internationalen Gefüge nicht gebührend berücksichtigt.
So ist es nicht in Stein gemeißelt, dass künftig noch jeder siebte 80-Jährige dement ist und jeder dritte 90-Jährige. Möglicherweise erleben wir hier ganz andere Entwicklungen, sei es in Form z. B. eines Alzheimer-Impfstoffs oder infolge veränderter Lebensweisen, die einen der Hauptgründe für die Heimaufnahme (nämlich die Demenz) zur Makulatur werden lassen könnte.
Weiterhin ist es keineswegs ausgemacht, dass die Menschen immer länger leben. Manche Biodemografen gehen beispielsweise für die USA schon davon aus, dass der Zenit überschritten ist. Steigende Belastungen verschiedenster Art oder schwindender Wohlstand können die Lebenserwartung durchaus wieder senken. So weisen beispielsweise Langzeitarbeitslose eine mehrere Jahre geringere Lebenserwartung auf, sterben Arme auch hierzulande immer noch früher. Es ist also gefährlich, Trends einfach langfristig fortzuschreiben.
In der Pflege werden Roboter bedeutende Teile der Aufgaben heutiger Pflegekräfte übernehmen können. Viele Senioren werden eher eine Maschine kaufen, als fremde, schlecht motivierte Personen mit ihrer Pflege zu betrauen. Japan ist auf diesem Feld der Robotik schon recht weit, und die rasant voranschreitende Technik wird noch für viele Überraschungen sorgen.
Nicht zuletzt werden Kostenaspekte immer wichtiger. Niemand wird ernsthaft glauben wollen, dass sich eine Gesellschaft nur noch um Pflege und allerlei Krankheiten drehen kann. Die deutlich geschrumpfte, jüngere Generation wird rasch streiken. Im Konkurrenzkampf mit erheblich jüngeren Nationen (Asien, Südamerika, langfristig auch etliche Regionen Afrikas) drohen wir dramatisch zurückzufallen – schlimmstenfalls werden wir die Dritte Welt von übermorgen.
Neue Formen seniorengerechten Wohnens und eine neue Solidarität der Betroffenen, und sei sie schlicht wirtschaftlich erzwungen, können zusammen mit den technischen Errungenschaften daher ebenfalls viele Pflegebetten unnötig werden lassen.
Vor diesem Hintergrund erscheint es nicht zukunftsweisend, zu große Personalkapazitäten in Bereiche fehlzuleiten, die erstens volkswirtschaftlich nur eine sehr begrenzte Wertschöpfungskapazität aufweisen (wie die meisten Sozialleistungen), und zweitens noch für die Beschäftigten ein großes Frustrations- und Enttäuschungspotenzial bieten. Nicht nur, dass die Arbeit fordernd ist und zu vielen, vorzeitigen Berufsaufgaben führt – sie steht langfristig unter einem Rationalisierungs- und Kostendruck, den wir uns heute angesichts eines wieder erblühenden Konjunkturpflänzchens nicht so recht vorstellen mögen. Vor diesem Hintergrund kann man nur staunen, wie viel Zeit und Geld bereits heute in der Pflege für eine teilweise bizarre Dokumentations- und Bürokratiekultur aufgewendet wird. Hier schlummern schon heute erhebliche Reserven, was aber niemand wahrhaben will.
Fazit
Vergessen wir nicht: Viele grundlegende Probleme unserer Wohlstandsgesellschaft, die im Moment noch geradezu in Geld badet, sind keinesfalls gelöst. Das sind wesentlich elementarere Fragen als die der Gesundheit und Pflege. Für alle diese sozialen Leistungen bedarf es schließlich einer gesicherten Wirtschaftsbasis.
Dass Deutschland in der vergangenen Krise so gut abgeschnitten hat, liegt daran, dass wir noch eine industrielle Basis haben. Mit Banken, Spekulationen und Immobilienmaklern lässt sich leider nur kurzfristig "Luftgeld" machen, und Dienst- und Sozialleistungen müssen erst einmal von jemandem bezahlt werden, der seine Mittel eben aus einer industriellen, international erfolgreichen Basis bezieht. Deshalb steht die Revitalisierung der Industrie auf der Agenda vieler Staaten weit oben, was nebenbei für uns perspektivisch verstärkte Konkurrenz bedeuten wird. Das ist ähnlich wie mit einem Schrank: Packen Sie immer mehr Dinge von den unteren Fächern nach oben, dann wird er irgendwann kopflastig – und kippt. Doch genau dieser Weg zeichnet sich auf vielen Feldern ab, und damit sind die Weichen in Richtung eines schleichenden Niedergangs gestellt.
Deshalb ist es geradezu existenziell, nach intelligenteren Lösungen zu suchen. Diese dürften in einer Kombination aus technischem Fortschritt, effizienten Strukturen, mehr Selbstverantwortung und Selbstbeteiligung sowie bei der Pflege in neuen Wohnformen und einer wieder auflebenden Solidarität auch ohne personelle und bürokratische Überfrachtung bestehen.
Wir sollten uns also nicht verrückt machen lassen und den talentierten Nachwuchs bevorzugt da einsetzen, wo er die Zukunft gestalten kann. Das Gesundheitswesen ist nur ein überschaubarer Teil davon, der nicht Gefahr laufen darf, den Rest der Gesellschaft wirtschaftlich in die Tiefe zu ziehen. Der Vergleich mit den militärisch-industriellen Komplexen der Vergangenheit und gegenwärtig noch jenseits des Atlantiks liegt auf der Hand.
Apotheker Dr. Reinhard Herzog, E-Mail: Heilpharm.andmore@t-online.de
Fachkräftemangel bei ApothekernEin Beitrag zum Thema Fachkräftemangel bei Apothekern war veröffentlicht in der Apotheker Zeitung Nr. 15 vom 11. April 2011. |



















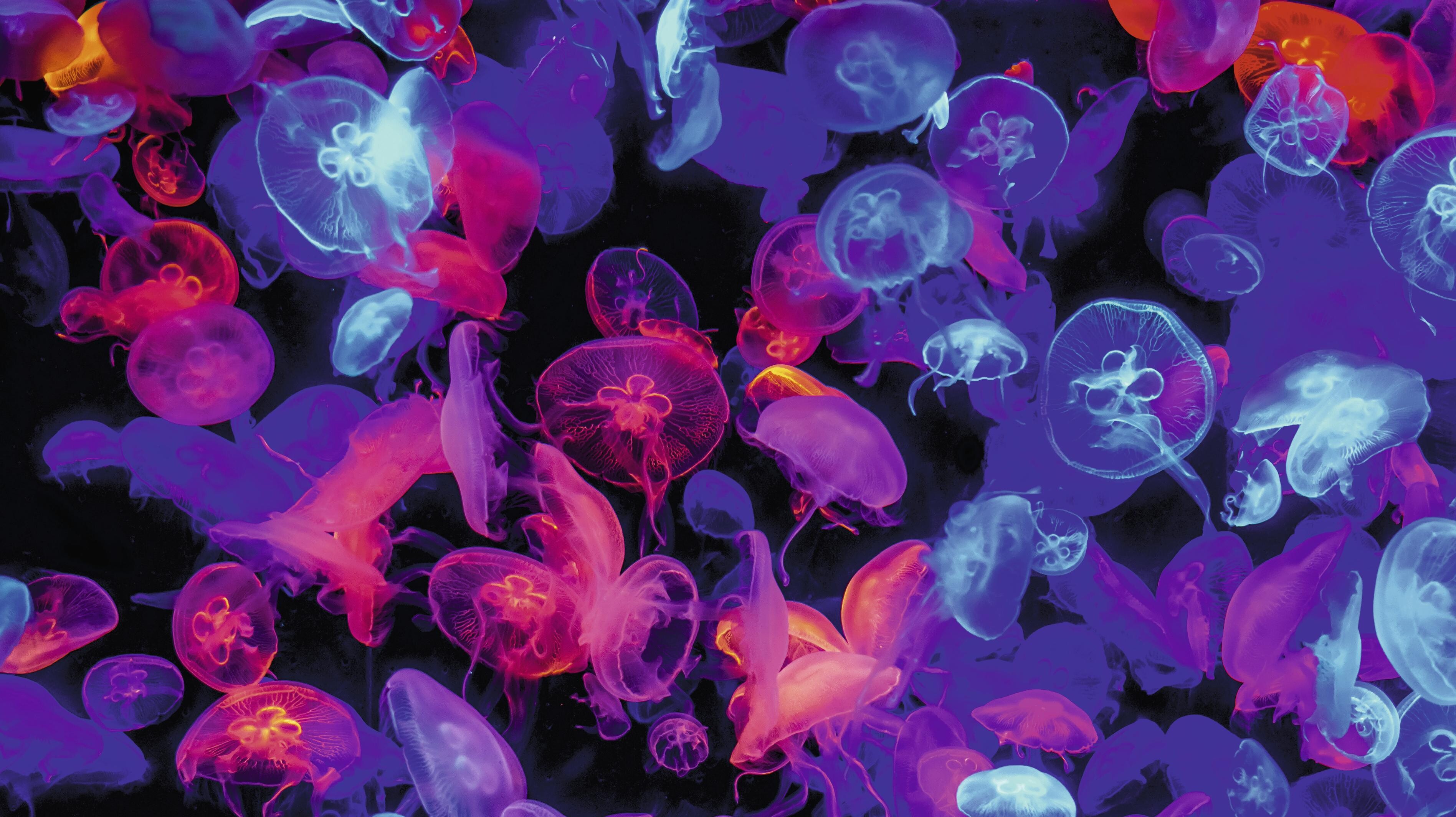



0 Kommentare
Das Kommentieren ist aktuell nicht möglich.