
- DAZ.online
- News
- Pharmazie
- Ist die Randomisierung ...
Die Evidenz-Sprechstunde
Ist die Randomisierung das Allheilmittel?
Stuttgart - 11.11.2016, 07:00 Uhr

Die Würfel müssen fallen: Der Zufall hilft bei medizinischen Studien erheblich – doch es gibt auch Tücken. (Foto: henryn0580 / Fotolia)
Entscheidend ist das Nicht-Wissen
Ebenso darf sich die Zuwendung und die Begleittherapie in Behandlungs- und Kontrollgruppe nicht unterscheiden. Dafür ist eine „Verblindung“ möglichst aller Beteiligten notwendig, so dass weder Arzt noch Patient noch Pflegepersonal wissen, zu welcher Gruppe der Patient gehört. Denn dieses Wissen kann sich an vielen Stellen auswirken: Für den Patienten selbst spielen etwa seine Erwartungen eine Rolle und wirken sich auf körperliche und psychische Reaktionen aus. Auch ist es möglich, dass das Wissen seine Entscheidung beeinflusst, wegen Nebenwirkungen oder ausbleibender Wirkung aus der Studie auszuscheiden, sich nicht an die Einnahmehinweise zu halten oder Kontrolluntersuchungen fernzubleiben.
Auch Ärzte und Pflegepersonal haben möglicherweise eine Einstellung zur jeweiligen Intervention, die sich auf den Patienten übertragen kann. Das Wissen um die Gruppenzugehörigkeit des Patienten kann sich auch auf medizinische Entscheidungen, Einschätzungen, Aufmerksamkeit oder zusätzlich angebotene Behandlungen auswirken. Bei der Erfassung der Endpunkte ist eine fehlende Verblindung besonders bei subjektiven Einschätzungen, etwa bei Schmerzen, problematisch. Gleiches gilt auch bei der Datenauswertung, etwa wenn es um den Umgang mit unklaren Befunden oder fehlenden Daten geht.
Alles zählt
Auch bei guter Studienplanung und sorgfältiger Betreuung wird es in der Regel Patienten geben, die die Therapie nicht wie verordnet durchführen, etwa weil sie die Nebenwirkungen nicht aushalten oder von der ausbleibenden Linderung ihrer Beschwerden enttäuscht sind. Werden am Ende der Studie nur die Patienten ausgewertet, die sich vollständig an die Regeln gehalten haben („per-protocol-Analyse“), verzerrt das das Studienergebnis. Weil der Studienabbruch meist im Zusammenhang mit der Therapie steht, sind die ausscheidenden Patienten in der Regel nicht gleichmäßig auf Behandlungs- und Kontrollgruppe verteilt, so dass die Randomisierung nicht aufrechterhalten wird. Deshalb sollten in der Studie die Patienten für die Gruppe ausgewertet werden, der sie ursprünglich zugeordnet waren („intention-to-treat-Analyse“). Fehlen Daten für Patienten ganz oder teilweise, gibt es statistische Strategien, um dieses Problem zu lösen.
Nicht alle Studien, die als randomisiert, kontrolliert und doppelblind angepriesen werden, sind tatsächlich aussagekräftig. Entscheidend ist, ob diese Prinzipien auch tatsächlich sachgerecht angewendet wurden. Aber selbst wenn die Studie eine hohe interne Validität aufweist, kann es weitere Probleme geben: Etwa wenn der Endpunkt keinerlei Relevanz für den Patienten hat, die statistische Auswertung fragwürdig ist, die Fallzahl für eine belastbare Aussage nicht ausreicht oder der Therapieeffekt winzig oder höchst unsicher ist. Deshalb lohnt es in jedem Fall, sich nicht auf das Label „RCT“ zu verlassen, sondern genau hinzuschauen.




















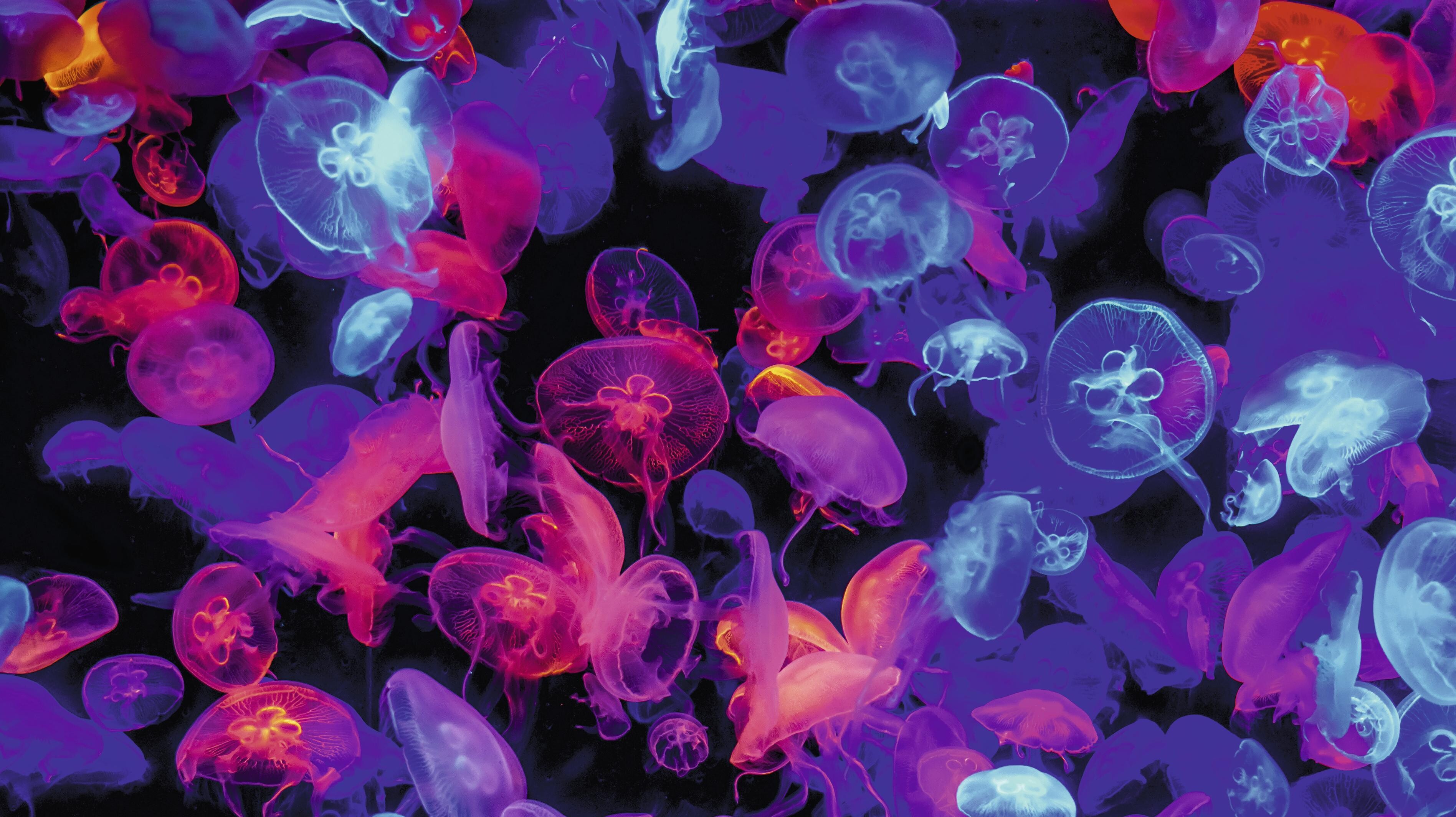



0 Kommentare
Das Kommentieren ist aktuell nicht möglich.