
- DAZ.online
- DAZ / AZ
- AZ 20/2020
- Länder nehmen E-Rezept ...
Gesundheitspolitik
Länder nehmen E-Rezept ins Visier
PDSG im Bundesrat
Anfang April hatte das Bundeskabinett den PDSG-Entwurf auf den Weg gebracht. Darin finden sich verschiedene Regelungen rund ums E-Rezept. In § 11 Apothekengesetz soll überdies das von der ABDA lange eingeforderte Makelverbot eingefügt werden: Neben „Ärzten oder Personen, die sich mit der Behandlung von Krankheiten befassen“, ist es demnach auch für „Dritte“ unzulässig, (E-)Verschreibungen zu sammeln, an Apotheken zu vermitteln oder weiterzuleiten und dafür einen Vorteil zu fordern, sich versprechen zu lassen, anzunehmen oder zu gewähren.
Zudem sind im Sozialgesetzbuch V flankierende Regelungen zum dort verankerten Recht auf freie Apothekenwahl vorgesehen (§ 31 Abs. 1 Satz 5 SGB V). Es soll durch ein grundsätzliches Zuweisungs- und Beeinflussungsverbot, adressiert an Vertragsärzte und Kassen, weiter abgesichert werden. Und zwar ausdrücklich auch im Hinblick auf das E-Rezept. Ausnahmen soll es nur geben, wenn gesetzlich etwas anderes bestimmt ist oder es aus medizinischen Gründen im Einzelfall erforderlich ist.
Genau hier regt nun der Gesundheitsausschuss des Bundesrates eine Änderung an. In seinen Empfehlungen für den ersten PDSG-Durchgang in der Länderkammer am 15. Mai schlägt er vor, das grundsätzliche Verbot dahingehend zu ergänzen, dass eine direkte Übermittlung von Verordnungen in Ausnahmesituationen nur dann erfolgen darf, „wenn der Versicherte oder dessen Vertreter dem Verfahren zuvor schriftlich zugestimmt hat und sich dieses transparent verfolgen lässt". Die Ausnahmetatbestände sollen in der Arzneimittel-Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses festgelegt werden.
Versorgungsalltag besser abbilden
In der Begründung heißt es, der Gesetzentwurf werde dem Versorgungsalltag in Bezug auf (elektronische) Verordnungen nicht gerecht. Ziel müsse sein, an einem grundsätzlichen Makelverbot festzuhalten, gleichzeitig jedoch Ausnahmesituationen zu definieren, um den Versorgungsalltag vollumfänglich abdecken zu können.
Aktuell gebe es einen solchen definierten Fall einer erlaubten direkten Rezeptübermittlung zum Beispiel in der Zytostatikaversorgung (§ 11 Absatz 2 ApoG). Doch die Gesundheitsfachleute der Länder erwarten durch die flächendeckende Einführung der Telemedizin und den vermehrten Rückgriff auf telefonische Behandlungen und Konsultationen weitere Situationen, in denen E-Rezepte direkt an Apotheken versandt werden sollten – etwa weil Versicherte nicht in der Lage sind, diese zu empfangen, aber auch nicht in die Arztpraxis oder Apotheke kommen können. Für solche Situationen bedürfe es definierter Ausnahmetatbestände und einer engmaschigen Kontrolle des Zuweisungsverhaltens, so der Ausschuss. „Nur so kann das aktuell stattfindende Makeln von Rezepten unter anderem per Fax zukünftig vermieden beziehungsweise zumindest transparent abgebildet werden“, heißt es in der Begründung der Empfehlung.
Um die Ausnahmesituation der direkten Zuweisung zu dokumentieren, muss der Versicherte oder sein Vertreter zuvor schriftlich zustimmen. Sie können dem Arzt die Einwilligung erteilen, in Ausnahmesituationen dort hinterlegte Rezepte zu übermitteln oder eine Stammapotheke benennen, an welche sämtliche Rezepte übermittelt werden. Ein Widerruf der schriftlichen Einwilligung soll jederzeit möglich sein. Zudem soll das Zuweisungsverhalten bei E-Rezepten statistisch auswertbar sein und bei Auffälligkeiten überprüft werden können. Es soll stets nachvollziehbar sein, wer wann welches Rezept verordnet hat und wo es eingelöst wurde.
Echte Wahl zwischen Papier- und E-Rezept
Der Ausschuss empfiehlt dem Bundesrat angesichts der ab 1. Januar 2022 geplanten E-Rezept-Pflicht zudem eine weitere Prüfbitte: Es soll im weiteren Gesetzgebungsverfahren geprüft werden, ob Versicherten ein Anspruch auf eine ärztliche Verordnung in Papierform eingeräumt werden kann. „Der Versicherte sollte bei den ärztlichen Verordnungen ein echtes Wahlrecht zwischen einer Verordnung in elektronischer Form und einer Verordnung in Papierform haben“, heißt es zur Begründung.
Derzeit sieht der PDSG-Entwurf nur vor, dass Versicherten die Zugriffsdaten auf das E-Rezept in Papierform ausgehändigt werden können. Doch das greift aus Sicht der Länderexperten zu kurz. Hier sollten aus Gründen der Arzneimitteltherapiesicherheit zusätzlich Mindestangaben zum verordneten Arzneimittel und seiner Anwendung vermerkt sein. |







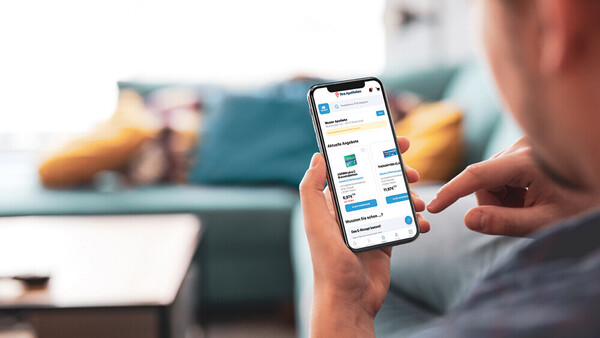
















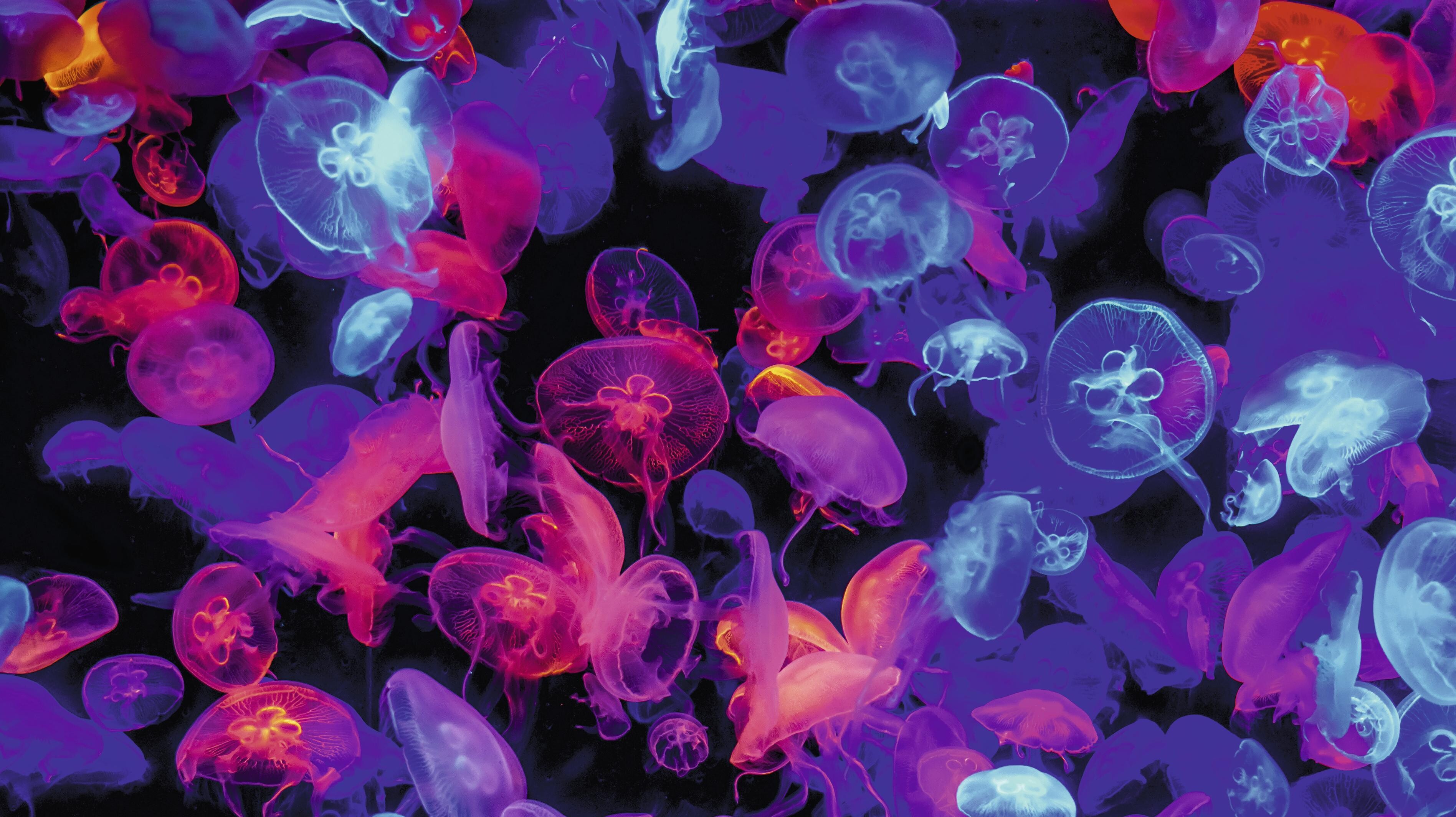



0 Kommentare
Das Kommentieren ist aktuell nicht möglich.