
- DAZ.online
- News
- Wirtschaft
- Pay for performance: Das ...
Vor- und Nachteile
Pay for performance: Das Erstattungsmodell der Zukunft?
Stuttgart - 08.08.2018, 11:40 Uhr

Für Kymriah gibt es in den USA Pay-for-Performance-Verträge. (c / Foto: picture alliance)
Wie kann das Gesundheitssystem bezahlbar bleiben? Insbesondere vor dem Hintergrund neuer, hochpreisiger Therapieansätze wie etwa Antikörper oder gentherapeutischer Ansätze stellen sich derzeit viele Verantwortliche diese Frage. Ein Modell, das dabei diskutiert wird, ist „Pay for performance“, also eine erfolgsabhängige Vergütung. Einige Vereinbarungen in diese Richtung gibt es schon, aber sie sind bislang noch die große Ausnahme. Zudem hat das Modell nicht nur Vorteile.
Das Handelsblatt beschäftigt sich in seiner Ausgabe vom heutigen Mittwoch mit dem Thema innovative Erstattungsmodelle für Arzneimittel. Hintergrund dieser Diskussion ist die stark wachsende Zahl an innovativen, aber sehr teuren Therapien und die Frage, wie man sie langfristig finanzieren kann. Aktuelles Beispiel ist die T-Zell-basierte Krebstherapie mit KymriahTM (Tisagenlecleucel), die in den USA einen Listenpreis von 475.000 US-Dollar hat.
Ein diskutiertes Model ist „Pay for performance“, mit dem sich auch der Handelsblatt-Artikel hauptsächlich befasst und bei dem die Erstattung davon abhängt, ob das Arzneimittel wirkt. Aus Sicht der Pharmaindustrie biete die erfolgsabhängige Vergütung eine Chance, die Akzeptanz für hochpreisige Arzneimittel zu stärken und zudem sicherzustellen, dass eine möglichst große Zahl von Patienten Zugang zu den Innovationen erhalte, heißt es. Für die Gesundheitssysteme böten sie die Sicherheit, dass nur Arzneimittel gezahlt werden, die tatsächlich wirken.
Auch Stefan Oschman, Chef des Darmstädter Pharma- und Chemiekonzerns Merck, sieht das so. Im Interview erklärt er gegenüber dem Handelsblatt, die Industrie müsse darstellen, welchen Wert ihre Produkte erbringen. Man müsse an das Thema Preise viel rationaler und weniger emotional rangehen, sagt er. Seiner Ansicht nach herrscht im Gesundheitssystem ein altes, überkommenes Denken: Es werde nach Aktivität bezahlt, also für das, was getan wird, und nicht für das, was erreicht wird. Ginge es nach Oschmann, würde sich der Preis daran orientieren, wie viel besser das Mittel im Vergleich zu bestehenden Therapieoptionen ist. Merck sei zu einem solchen Systemwechsel bereit, die Politik sei am Zug.
Viel Bürokratie und fehlende Bewertungsmaßstäbe
In Deutschland seien die Hürden für neue Preismodelle aber hoch, schreibt das Handelsblatt weiter. Zwar gebe es für Firmen grundsätzlich die Möglichkeit, mit Kassen Einzelverträge für patentgeschützte Arzneimittel auszuhandeln. Seit Einführung der AMNOG-Gesetze im Jahr 2011 und der damit verbundenen Nutzenbewertung und der Verhandlung von Erstattungsbeträgen gebe es aber diesbezüglich keine Aktivitäten mehr. Zur Erklärung: Der Erstattungsbetrag orientiert sich zwar am Zusatznutzen gegenüber der Standardtherapie, dies betrifft allerdings nicht den individuellen Zusatznutzen, sondern den im Vorfeld vom Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) anhand von Studiendaten festgelegten Zusatznutzen.
Gegen Pay for performance spreche außerdem die hohe Komplexität der Modelle und der damit verbundene administrative Aufwand, heißt es in dem Beitrag weiter. Sie seien in vielen Bereichen kaum realisierbar. Zum einen fehle es an Maßstäben zur Erfolgskontrolle, zum anderen müsse man den Wert des medizinischen Erfolges bemessen. Und selbst wenn das gelingen sollte, müssten sich die Beteiligten einigen, wie viel von diesem Wert der Pharmafirma zusteht.
Kassen zurückhaltend
Dementsprechend zurückhaltend äußert sich der AOK-Bundesverband: „Neue Preiskonzepte sollte man nicht als Allheilmittel darstellen, weil diese Modelle oft nur unter hochbürokratischen Voraussetzungen umsetzbar sind“, heißt es gegenüber dem Handelsblatt. Der GKV-Spitzenverband (GKV-SV) kann sich alternative Preismodelle bei neuen Behandlungsformen offenbar grundsätzlich vorstellen. Derzeit werde geprüft, wie die finanziellen Belastungen des Systems durch diese Preismodelle eingegrenzt werden können. Eine Sprecherin erklärt gegenüber dem Handelsblatt: „Pay-for-Performance-Modelle“ gehören zu den diskutierten Möglichkeiten.
In einer früheren Stellungnahme zu diesem Thema erklärte der GKV-SV zudem, dass bei Rabattverträgen mit Pay-for-Performance-Klausel die Herausforderung in der Definition des Behandlungserfolges und dessen Überprüfung liege – Bedenken, die der Handelsblatt-Beitrag ebenfalls äußert. Damit verbunden sei ein notwendiges Verfahren zur Übermittlung und Analyse von Patientendaten zwischen der Kasse und dem Hersteller. Unter Umständen müssten auch Daten von Ärzten und Apothekern eingebunden werden, so der GKV-SV.
Was sagen die Industrieverbände?
Auch seitens der deutschen Industrieverbände war das Echo zumindest vor zwei Jahren noch gemischt: So erklärte Hermann Kortland, stellvertretender Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes der Arzneimittel-Hersteller (BAH), auf Anfrage: „Der BAH begrüßt grundsätzlich Möglichkeiten, den Vertragswettbewerb um eine optimale Patientenversorgung zu fördern. Eine Möglichkeit hierzu stellen Pay-for-Performance-Verträge dar.“ Zurückhaltender äußerte sich damals der Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie (BPI): „Pay for Performance ist nur erfolgreich, wenn als Ergebnisindikator zu messen ist, was als Ziel intendiert ist, nämlich eine bessere Versorgungsqualität beim Patienten. Da zur Messung von Versorgungsqualität noch kein wissenschaftlicher Konsens besteht, sehen wir nicht, dass es auf das Gesundheitssystem in Deutschland zu übertragen ist.“ Allerdings räumte eine BPI-Sprecherin ein, dass es jedem Unternehmen unbenommen bliebe, freiwillig entsprechende individuelle Vereinbarungen einzugehen.
Es gibt Verträge – aber sie sind die Ausnahme
Einige Verträge dieser Art gibt es auch schon. Als Vorreiter gelten vor allem die Schweizer Konzerne Roche und Novartis. Nach Informationen der Schweizer „Handelszeitung“ übernimmt Roche in Deutschland seit 2007 einen Teil der Behandlungskosten, wenn Patienten eine hohe Dosis Avastin® erhalten. In Italien hat das Unternehmen bereits vor Jahren einen Pay-for-Performance-Vertrag mit der Arzneimittelbehörde zu Avastin® (Bevacizumab) geschlossen. In Fällen, in denen das Roche-Medikament nicht hilft, soll es eine komplette Rückerstattung geben. Novartis hat beispielsweise für Entresto® (Sacubitril, Valsartan), ein innovatives Mittel gegen Herzinsuffizienz, derartige Verträge mit US-Krankenkassen. Und auch für KymriahTM gibt es schon derartige Verträge in den USA.
Das Handelsblatt nennt auch Zahlen: So liste das Beratungsunternehmen McKinsey gut 200 solcher Verträge seit 1994, die Marktforscher von Iqvia kommen auf 24 Vereinbarungen in den USA in den letzten fünf Jahren, deren Anzahl sich aber in den nächsten fünf Jahren mehr als verdoppeln werde, so die Prognose. Die Gesamtzahl dürfte höher liegen, da nicht alle Absprachen publiziert werden, so komme die Datenbank der Universität von Washington auf 463 innovative Preismodelle. Gemessen am Gesamtmarkt sei der Anteil jedoch gering. Zu diesem Schluss kommt das Handelsblatt.










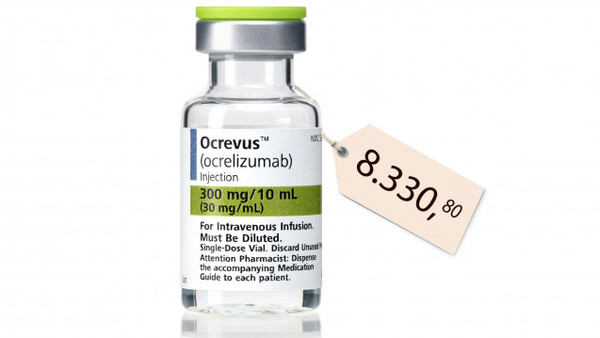














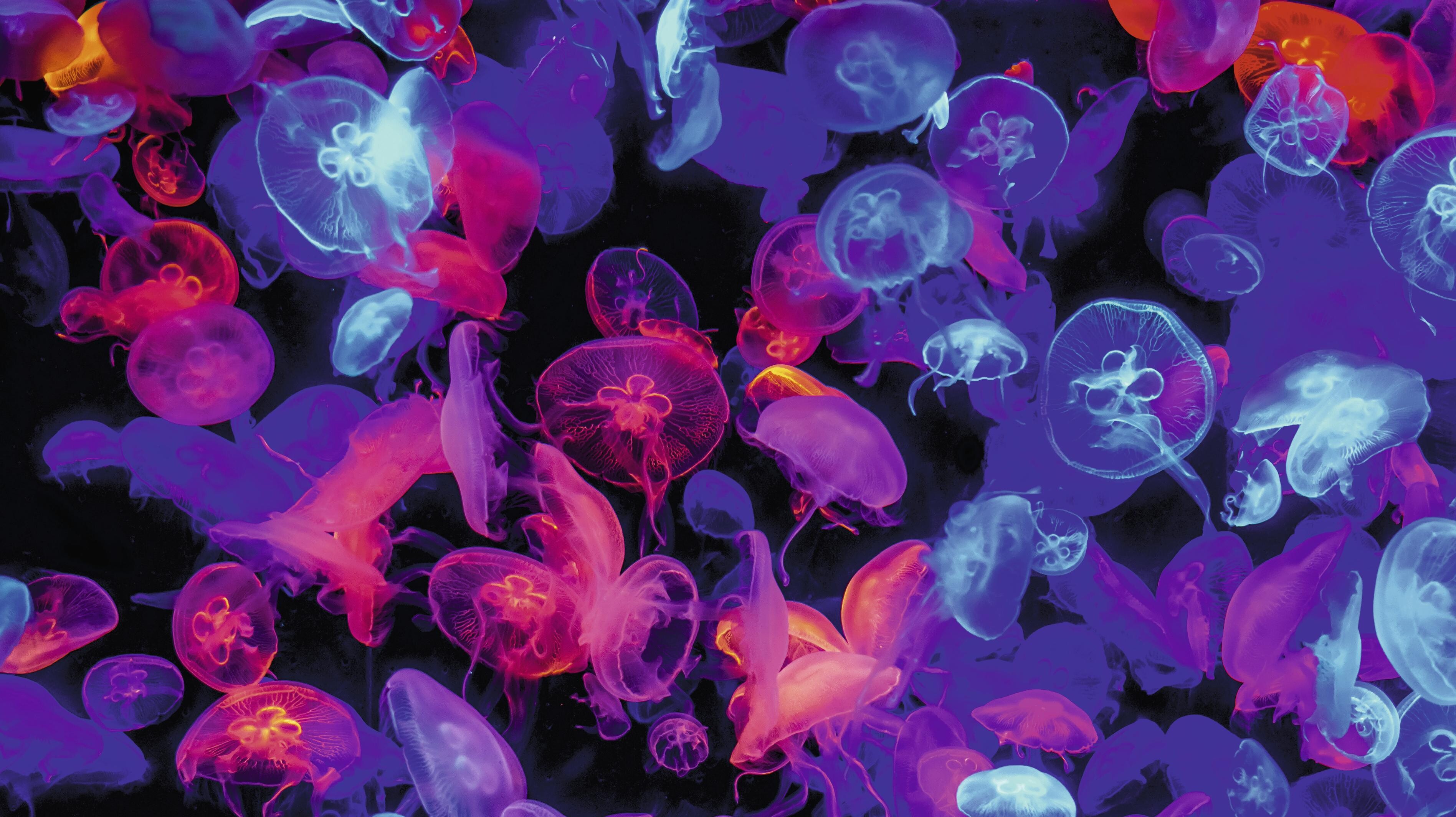



0 Kommentare
Das Kommentieren ist aktuell nicht möglich.