Suizide in Deutschland: Wo finden Gefährdete Hilfe?
In Deutschland sterben jedes Jahr etwa 10.000 Menschen durch Suizid – das sind so viele wie durch Verkehrsunfälle, HIV, illegale Drogen und Gewalttaten zusammen. 70 Prozent der durch Suizid Verstorbenen sind Männer, das durchschnittliche Lebensalter liegt bei 58 Jahren.
Die Anzahl der Suizidversuche liegt deutlich höher: Rund 100.000 Menschen versuchen jährlich sich das Leben zu nehmen. Die Versuche zum Suizid werden hauptsächlich von jüngeren Frauen unternommen. Etwa jeder Dritte unternimmt einen weiteren Versuch, zehn Prozent sterben letztendlich.
Suizidversuche sollten immer ernst genommen werden, als „Hilferufe“ der Betroffenen und Zeichen schwerwiegender psychischer Probleme.
Hilfe, auch anonym, finden Betroffene bei der Telefonseelsorge, die auch im Chat oder per E-Mail erreichbar ist.
Suchen Menschen Hilfe in einem persönlichen Gespräch, können sie sich an Ärzte, Psychologen, psychiatrische Kliniken, Psychiater und Pfarrer (Rabbiner, Imam) wenden. Ärzte und Psychologen unterliegen der Schweigepflicht. Pfarrer sind an das Beicht- und Seelsorgegeheimnis gebunden.
Die Seite für Suizidprophylaxe nennt ebenfalls Anlaufstellen für Betroffene. Auch gibt es eigene Beratungsangebote für suizidgefährdete Jugendliche. Das Besondere: Die Jugendlichen werden von speziell ausgebildeteten Gleichaltrigen betreut.
























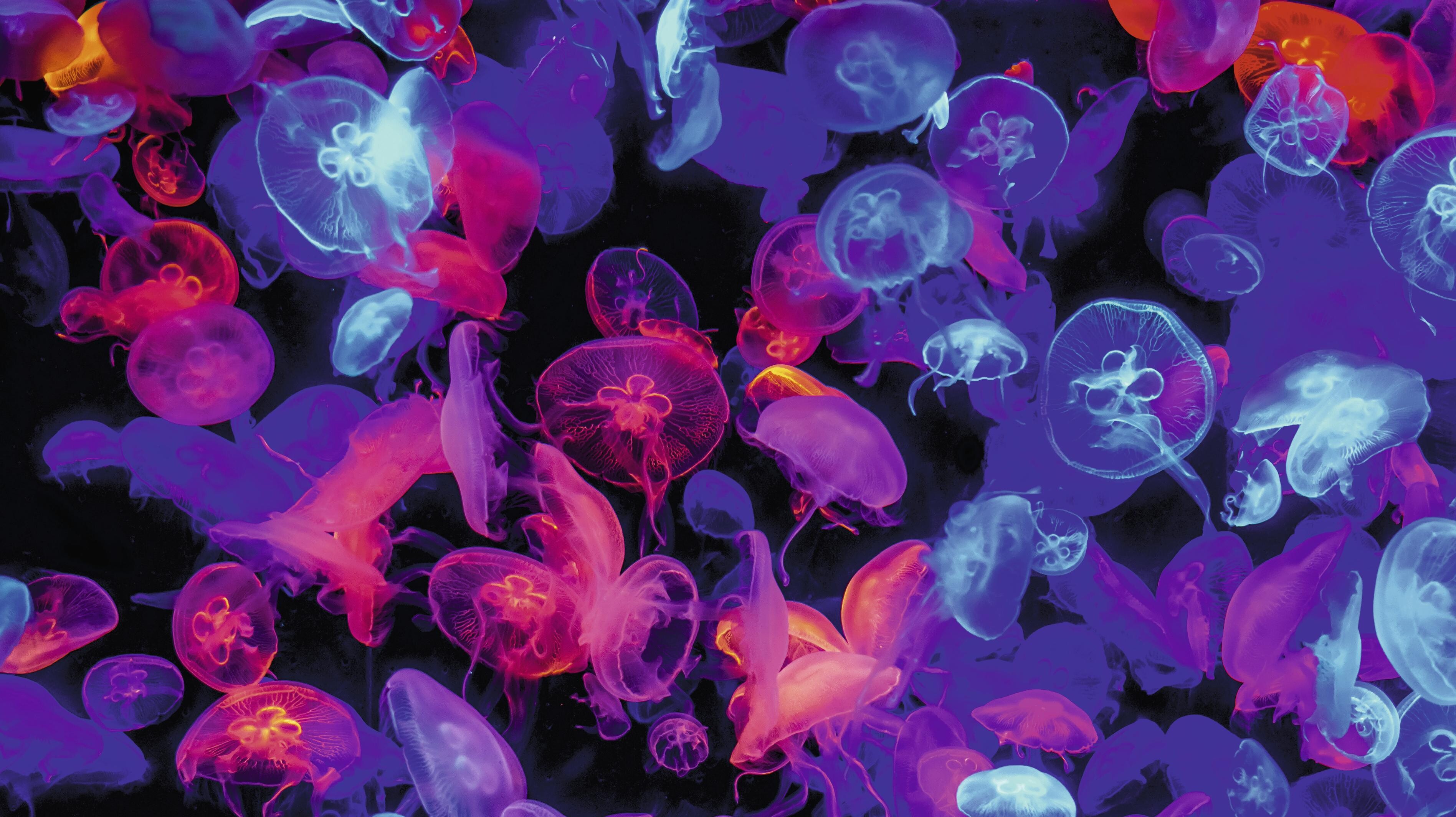



0 Kommentare
Das Kommentieren ist aktuell nicht möglich.