
- DAZ.online
- News
- Emotionale Debatte über ...
Tabuthema im Bundestag
Emotionale Debatte über Sterbehilfe
In Deutschland gibt es etwa 2,6 Millionen Pflegebedürftige. 340.000 sterben jährlich in stationären Pflegeeinrichtungen, viele unter extremen Schmerzen. In Ausnahmefällen wollen diese unheilbar kranken Patienten ihrem Leben ein Ende setzen – und hoffen, da sie meist selbst dazu kaum mehr in der Lage sind, auf Hilfe. Am heutigen Donnerstag debattierten Bundestagsageordnete fast fünf Stunden über Sterbebegleitung und Sterbehilfe – ohne Fraktionszwang, dafür sensibel, würde- und respektvoll.
Einige Abgeordnete schilderten ihre persönlichen Erfahrungen mit Sterbenden im privaten Umfeld. Die Parlamentarier hoffen, eine breite öffentliche Diskussion anzustoßen, um dann in der zweiten Jahreshälfte 2015 ein Gesetz verabschieden zu können.
Große Übereinstimmung bestand darin, die Sterbebegleitung, die Palliativ- und Hospizversorgung deutlich auszubauen. Renate Künast von den Grünen sagte: „800.000 Menschen brauchen Palliativmedizin- und Hospizplätze, 35.000 bekommen sie.“ Auch wenn Gesundheitsminister Hermann Gröhe (CDU) diese Zahlen nicht bestätigen wird, räumt er ein, dass hier wesentlich mehr passieren muss. Noch vor der Bundestagsdebatte legte Gröhe ein Konzept für eine flächendeckende Palliativ- und Hospizversorgung vor.
Was aber ist, sagte Bundestagsvizepräsident Peter Hintze (CDU) mit belegter Stimme, mit Menschen im Todeskampf, mit „Panik vor dem Erstickungstod“, mit schlimmem Krebsgeschwür im Mund, das schmerzt und stinkt? „Bei einer todbringenden Krankheit geht es nicht mehr um das Ob des Sterbens, sondern um das Wie.“
Hintze will mit anderen Koalitionsabgeordneten Patienten in solchen Extremsituationen unter bestimmten Bedingungen einen vom Arzt unterstützten Suizid ermöglichen. Das solle gesetzlich geregelt werden, um dem Mediziner mehr Rechtssicherheit zu geben.
Hintze und SPD-Fraktionsvize Carola Reimann berufen sich bei ihrer Position auf Studien, wonach drei Viertel der Befragten für Sterbehilfe durch Ärzte plädieren. Was aber ist eine Umfrage unter „gesunden“ Bürgern wert? Kann ihnen in dem Moment der Befragung klar sein, über welche intime, einsame, angstvolle, leidbeschwerte Lebenssituation sie reden?
Michael Brand (CDU), der mit seiner Position die Unionsmehrheit um Fraktionschef Volker Kauder und Gröhe vertritt, warnte gleich zu Beginn der Debatte: „Bei Sterbehilfe schafft Angebot Nachfrage.“ Wer diese Tür auch nur einen Spalt breit öffnen helfe, werde sie nicht mehr schließen können. Eine Zulassung erhöhe den Druck auf Sterbende, niemandem zur Last fallen zu wollen.
Bis auf eine Gruppe von Linken- und Grünen-Abgeordneten um Künast lehnt die überwiegende Mehrheit des Bundestags organisierte Sterbehilfe etwa in Form von Vereinen ab. Kommerziell orientierte Vereine wie die von Roger Kusch will gar keiner. Er sei dankbar, dass sich hier ein breiter Konsens abzeichnet, sagte Kauder. Für ihn gehe es darum, das Vertrauensverhältnis zwischen Arzt und Patienten zu stärken und „nicht durch gesetzliche Regelungen zu stören“. Um ohne gesetzliche Eingriffe auszukommen, müssten allerdings alle regionalen Ärztekammern ihr Standesrecht angleichen, machte SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann deutlich.
Die Debatte steht am Anfang. Fünf Positionspapiere liegen vor. Es ist nicht zu erwarten, dass jedes Papier in einen Gesetzentwurf mündet. Die Argumentationslinien dürften zwischen der Position der Unionsmehrheit um Brand, Gröhe und Kauder und der der Koalitionsgruppe um Hintze und Reimann verlaufen: Braucht das Arzt-Patienten-Verhältnis in der Extremsituation des Sterbens eine neue Rechtsgrundlage oder reicht die alte?
Eine scheinbare Brücke schlug bereits die Unionsmehrheit. Sie will zwar jegliche organisierte Sterbehilfe verbieten – auch eine organisierte Form des ärztlich begleiteten Suizids. Nur in Einzelfällen könne der Arzt einem Patienten ein Medikament zum Suizid zur Verfügung stellen. Für Hintze und Reimann dürfte sich an der Stelle aber die Frage stellen, wie gerade für Palliativmediziner der Einzelfall definiert wird.


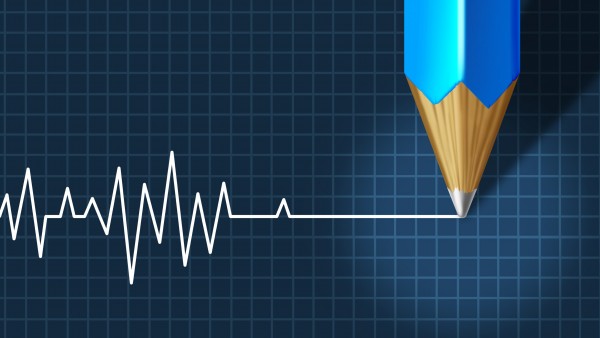
























Berlin - 13.11.2014, 17:45 Uhr